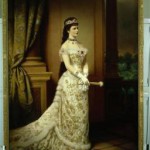Kaviar und Trüffel kennen viele. Nur wenigen liegen jedoch auch Blauer Hummer, Zampone, Kapaun oder Bottarga auf der Zunge. Alle Feinschmecker suchen den unverfälschten Geschmack, authentische Lebensmittel jenseits industrieller Massenproduktion. Wie köstlich können Walderdbeeren, Bärenkrebse und Glasaale sein, wenn man nur an die richtige Adresse kommt. Klassiker, Schlichtes und Exotisches – alles hat seinen Reiz. Das Buch „100 Dinge, die Sie einmal im Leben gegessen haben sollten“ bringt kulinarische Porträts, Geschichten hinter den Delikatessen, Bezugsquellen und Einkaufstipps. Es wird zudem verraten, wie man Original und Fälschung unterscheiden kann und vermeidet auf manipulierte Lebensmittel hereinzufallen.
So schön kann doch ein Fuß sein
Italiens schweinischer Gassenhauer Zampone
Von Jörg Zipprick

Zampone
Dass sich unsere italienischen Nachbarn mit Füssen auskennen, das weiß man auf der ganzen Welt. Mein Schuhschrank ist der Beweis dafür. Niemand macht so formschöne und gleichzeitig bequeme Schuhe wie die Leute, die in einem Land wohnen, das die Form eines Stiefels aufweist. (Allein die geniale Erfindung der Tod’s-Mokassins mit ihren 133 Gumminoppen, die jeden Träger federnden Fußes über den Boden schweben lassen, ist genial und zeigt die Fuß-Affinität der Italiener). Aber dass sie auch noch aus einem Schweinefuß eine Delikatesse machen können, ist noch erstaunlicher.
Während wir in unseren Breitengraden Haxenbratereien haben und nach den krossen Krusten des Borstentiers gieren, geben sich die Bewohner der Emilia Romagna nicht mit solchen langweiligen Einfachheiten ab. Sie haben einen gefüllten Schweinefuß kreiert, der einen eindeutigen kulinarischen Abdruck hinterlässt. Auch im Bollito misto darf der Zampone – der „große Fuß“ – nicht fehlen. Ich hab nur einmal davon probiert und war mehr als angetan. Aber das Geheimnis dieser italienischen Schweinefuß-Spezialanfertigung habe ich noch nicht ergründet.

Hummer
Im Bürokratendeutsch der „Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vom 14. Juli 1992“, Antrag auf Eintragung gemäß Artikel 17, ist ein Zampone ein „Fleischerzeugnis, bestehend aus einer Mischung von Schweinefleisch aus der quergestreiften Muskulatur, Schweinefett, Schwarte und verschiedenen Gewürzen, die in natürliche Umhüllungen, nämlich die Außenhaut des vollständigen Vorderfußes des Schweins (mit den Zehenknochen) gefüllt wird; das obere Ende wird verschlossen. Das Erzeugnis muss leicht aufschneidbar sein. Beim Anschnitt weist die Scheibe rötliche bis rote uneinheitliche Färbung auf, sie ist kompakt und besitzt einheitliche Körnung.“ Eingetragen wurde die Zampone als „geprüfte geografische Angabe“, eine europäische „Auszeichnung“, die jedoch über die Wurstqualität in diesem Fall rein gar nichts aussagt.
Fragen wir uns doch lieber zuerst, warum jemand Wurst in Schweinsfüße füllt: Im Winter 1511 wurden Mirandola und das nahe Modena von den Truppen des Papst Julius II belagert. Falls Sie einmal Opfer einer Belagerung werden, was heute ja Gott sei Dank seltener vorkommt, müssen Sie wissen, dass richtige Vorratshaltung sehr wichtig ist, um selbige durchzustehen. In Mirandola jedenfalls wurde die Schlachtung der Schweine befohlen, um zu verhindern, dass die kostbaren Fleischlieferanten den Feinden in die Hände fielen bzw. deren Mägen füllten. Doch worin sollte man all das Fleisch aufbewahren? So wurde das Schwein selbst zum Behältnis, in dem man auch die Vorderbeine der Schlachttiere füllte. Später, als die Gefahr vorbei war, fand die neue Spezialität bald auch viele Freunde außerhalb von Strategen und Militärs.

Jacobsmuscheln
Ein großer Zampone-Freund war der Komponist Gioacchino Rossini (1792 – 1868), was an sich schon ein Gütesiegel ist. Dessen Wissen um die kulinarischen Künste wurde höchstens noch von seinen nachweislich exzellenten Kenntnissen über die richtigen Noten übertroffen. Obwohl das Ansichtssache ist. „Wenn er so viel von Musik versteht, wie von Makkaroni, dann muss er sehr gute Sachen schreiben“. Dieser Spruch eines Pasta-Händlers wurde in Rossini-Biographien verewigt, der Komponist selbst schrieb ausführlich und gern über das Essen. Er sandte dem Metzger Bellantini in Modena folgende Bestellung: „Ich möchte sechs Capelli da Prete (Priesterhüte, eine Wurstspezialität mit Zampone-ähnlicher Füllung, eingenäht in einen Dreispitz), ähnlich denen, die du mir nach Florenz geschickt hast. Vier Pfoten und vier Würstchen, alles von der besten Qualität.“ Wohl „um Missverständnisse zu vermeiden“ legte Rossini angeblich eine Risszeichnung eines Zampone bei.
Es war kein Zufall, dass Rossini bei dieser Adresse bestellte, denn traditionell hat jeder Metzger sein eigenes Rezept: Aber alle benötigen eine intakte Schweinepfote ohne Schnitte oder andere Verletzungen der Haut und alle vernähen den fertig gefüllten Fuß per Hand. Viele der Füßchen werden in speziellen Dampföfen gegart, bevor ihre Füllung bei Raumtemperatur fest wird. Das Geheimnis des Zampone jedoch liegt natürlich in seinem Innersten: Welche Sorten Schweinefleisch werden verwendet? Wie werden sie gewürzt?

Bottarga
Viele Metzger verwenden heute Wange, Kopf, Hals und Schulter, Salz und Gewürze. Dabei geht die Tendenz zum „mageren Schweinsfuß“. Noch in den 1980er Jahren empfahl die Universität Rom 35 Prozent Schweinefleisch, mehrheitlich aus der Schulter, 30 Prozent Schwarte, 35 Prozent „Reste“ (parte ghiandolare, also „Drüsenteile). Inzwischen werden die Füßchen mit 60 Prozent magerem Schweinefleisch und vielleicht 20% Schwarte erzeugt. Gewürzt wird mit Zimt, Salz, Pfeffer, Muskatblüte, Nelken, Muskat und teilweise vielen anderen guten Sachen. Auch die Feinheit (oder Grobheit) des Schweinehacks spielt eine Rolle. Zum guten Schluss wird ein Zampone etwa einen halben Tag lang gewässert, mehrfach eingestochen und dann nochmals stundenlang vor dem Servieren gegart.
Früher gab es vielfach rohe Zampone, heute sind die meisten aus Gründen der Haltbarkeit gegart. Deshalb „würzen“ Metzger auch zuweilen mit den Zusatzstoffen E 250 und E 252 (die Stabilisatoren Natriumnitrit und Kaliumnitrat). Erhalten haben sich allerlei Zampone-Feste. Eines wird von der Vereinigung der Metzgermeister von Modena veranstaltet, die 1995 den weltgrößten Zampone ins Guinness-Buch eintragen ließen. Regelmäßig feiern auch die „Ritter des Zampone“, deren damaliger Präsident Giorgio Fini 1971 für einen Skandal sorgte, als er Zabaione zum Zampone servieren ließ. Süßes zum Zampone, das wurde später zur Mode, in Frage kommen neben Zabaione auch Marsala und Balsamico. Eine der besten, aber auch teuersten Zampone-Adressen, ist nach wie vor die Salumeria Giuseppe Giusti in der Via Farini, 75 in Modena. Seit 1605 wird hier Wurst gemacht. Etwas günstiger, aber nicht unbedingt schlechter, ist die Wurst bei Regnani Sisto, in der Via XXIV Maggio, 4 in Serramazzoni, Modena. Allerdings verzichtet dieser Metzger nicht immer auf Zusatzstoffe, was wirklich schade ist.

Jörg Zipprick
Oft herrscht nur Nepp
Gespräch mit Gastronomie-Journalist und Buch-Autor Jörg Zipprick
BISS: In Ihrem kürzlich erschienen Buch „In Teufels Küche“ kommt die Gastronomie nicht sehr gut weg. Jetzt wollen Sie uns „100 Dinge“ schmackhaft machen. Passt das?
JZ: „In Teufels Küche“ ging es größtenteils um Zustände in sogenannten Top-Restaurants und Allianzen der Industrie mit Spitzenköchen. Besonders in der Avantgarde wird das Restaurant zum Showroom der Chemie-Industrie. Österreichs führendes Nachrichtenmagazin „Profil“ hat ausgehend von dem Buch übrigens eigene Recherchen angestellt. Und die sind wirklich lesenswert: http://www.profil.at/articles/1110/560/291269/schummelnde-spitzenkoeche-kritiker-allianzen-industrie
Aber natürlich liebe ich weiterhin gutes Essen „100 Dinge“ verrät, wo man gute Zutaten findet. Viele kann man roh verzehren. Wer einen Ofen, eine Pfanne und einen Kochtopf bedienen kann, dürfte auch den Rest problemlos zubereiten und wird sich hoffentlich über kräftigen, ursprünglichen Geschmack freuen.
BISS: „Nur 100 Zutaten? Sollte man nicht viel mehr gekostet haben?“
JZ: „Natürlich. Wir hätten auch 999 schreiben können. Ein paar unser Lieblingszutaten konnten wir nicht mehr unterbringen. Aber 100 sind 100 und da musste gesiebt werden. Wichtig war uns, dass das Buch kein Kuriositätenkabinett wird: Wir reden wegen des Nervenkitzels über Fugu und wegen des geradezu verblüffenden Salzgehalts über Umeboshi. Doch Exotik allein sagt nichts über den Geschmack. Kapitel über Krokodil, Zebra, Schlange und Heuschrecke gibt es nicht. “
BISS „Ein gutes Risotto gibt es auch nicht…“
JZ: „Rezepte gibt es bei uns nicht, sondern Zutaten, ihre Geschichte und Tipps zum richtigen Aussuchen. Wenn Zubereitetes, dann wurde es von einem Handwerker wie einem Metzger zubereitet. Und, ganz wichtig, das Produkt muss, wenn auch manchmal mit Schwierigkeiten, verfügbar und zu bestellen sein. Etwa bei der Butter, die es nur beim Hersteller Bordier gibt. Was nutzt das köstlichste Schwarzbrot, wenn es nur bei einem Bäcker im Schwarzwald erhältlich ist, der es nicht versenden kann. Bei der Avocado ist die Lage hingegen einfach: Wir finden eine Sorte leckerer als die anderen. Erhältlich ist sie fast überall.

Kaviar-Degustation
BISS: Was muss man denn nach ihrer Ansicht gekostet haben? Kaviar, Hummer und Languste?
JZ: „Es darf auch mal Kaviar sein. Aber Haselnuss, Morcheln und Kapern sollte jeder auch mal gegessen haben.“
BISS: „Manchmal scheint bei Ihnen das schlechte Gewissen mit am Schreibtisch gesessen zu haben. Sie weisen ausdrücklich auf fragwürdige Zuchtmethoden und aussterbende Tierarten hin….“
JZ: „Ich denke, auch Essen und Trinken verdienen journalistische Sorgfalt. Fakten gehören auf den Tisch, bzw. in das Buch, damit der Leser sich eine Meinung bilden kann. Leider ist das unter „Gourmets“ nicht überall mehrheitsfähig, die Gastronomie wird anscheinend als Freizeitpark für die Papillen wahrgenommen.
Doch nur das Wissen um fragwürdige Zucht- und Lagermethoden erlaubt es uns, gezielt nach guten Züchtern zu suchen. Zudem existiert allerlei Nepp, auch bei teuren Zutaten. Wer weiß schon, dass Thunfisch teilweise mit Kohlenmonoxid rot gefärbt wird? Und manchmal war ich beim Schreiben selbst schockiert: Aal und Kabeljau zum Beispiel waren in meiner Jugend Fische für alle Tage. Heute sind die Bestände bedroht.“

BISS: Das Buch erscheint wie ein feinschmeckerischer Dialog zwischen Ihnen und Ihrer Co-Autorin Margit Schönberger.
JZ: „Und die Zusammenarbeit hat sich ganz selbstverständlich so entwickelt, dass Margit eher für das Sinnliche und ich eher für das Warenkundliche zuständig war. Trotzdem waren wir selbst über das hohe Maß an Konsens erstaunt – wir haben da wohl einen kompatiblen Geschmack und einen gemeinsamen Sinn für Genuss.“
BISS: Sind solche Listen nicht immer subjektiv – auch wenn gleich zwei Autoren aktiv werden?
JZ: „Selbstverständlich – und dazu bekennen wir uns ausdrücklich. Wir hätten die Zutaten auch von salzig bis zuckersüß oder von steinhart bis ganz weich ordnen können und mit Slogans wie „lernen sie essen“ bewerben können. Solch pseudowissenschaftliche Verbrämung ist momentan ja populär. Eine subjektive Liste wäre es trotzdem geblieben, egal wie der Inhalt geordnet ist. Nun kann Genuss für jeden Menschen etwas anderes sein. Der Leser darf sich ruhig fragen, welche 100 Nahrungsmittel er auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen würde. Oder für zu Hause kaufen möchte….“
BISS: Kann man Sie denn mit ein paar der „100 Dinge“ zurück ins Restaurant locken?
JZ: „Einer wird das wahrscheinlich können: Der Neurologe Dr. Miguel Sanchez Romera, in „Teufels Küche“ ausführlich erwähnt, eröffnet demnächst ein Lokal in New York. Er kocht u.a. mit essbaren Blumen und ist der einzige wahre Erfinder unter den Köchen – was sich mit einem entsprechenden Patent auch beweisen lässt. Ich kenne seine Gerichte ja schon aus Barcelona, bin aber sehr neugierig, was er sich hat einfallen lassen. Das Wall Street Journal gibt ihm gehörige Vorschusslorbeeren: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703421204576329403800844910.html

Über Zampone und andere interessante Produkte liest man in dem neuen Buch
100 Dinge, die Sie einmal im Leben gegessen haben sollten
Margit Schönberger, Jörg Zipprick, Ludwig Bucherverlag, München 2011
19,99 €