Statt Dinner for One
Dinner on the Run
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Menschen kennen zulernen. „Dinner on the Run“ bietet eine besonders ungewöhnliche und amüsante. Das „laufende Essen“ ist ein kulinarisches Gesellschaftsspiel mit fliegenden Köchen, flammenden Herden und mitunter sogar feurigen Begegnungen. Der Schauspieler und Moderator Rudy Meidl führt inzwischen seit 11 Jahren Regie bei Dinner on the Run und bringt die unterschiedlichsten Menschen im Wechsel in verschiedenen Küchen zusammen. Gerade für solche, die neu in der Stadt sind, bietet dieses Dinner neben Kontakten auch eine gute Orientierung, denn man wechselt von Stadtteil zu Stadtteil und lernt en passant Frankfurt besser kennen.
Das Procedere: Jeder Teilnehmer bekommt einen Partner zugeteilt, mit dem er für einen Abend ein Team bildet. Man kocht gemeinsam eine Vorspeise, ein Hauptgericht oder ein Dessert – wie´s beliebt frei aus dem Kopf oder getreu nach Rezept. Zu diesem Team kommen dann zwei andere Teams als Gäste. Die beiden übrigen Gänge nimmt man in anderen Küchen bei wechselnden Gastgebern ein. Auf diese Weise tafelt man an einem Abend mit mindestens einem Dutzend anderer Leute.

Dinner-Moderator Rudy Meidl
17 Uhr, Römerberg 10. Rudi und seine Kochpartnerin Waltraud sind seit über zwei Stunden damit beschäftigt, eine sommerliche Vorspeise aus der Zeitschrift „Essen & Trinken“ nachzukochen. Zucchini, Tomaten und Paprika, gefüllt mit Fisch und oder Gemüse. Die sonst so ordentliche Küche ist nach dem Gemüsegemetzel nicht wieder zu erkennen. Um 18 Uhr erscheinen die Gäste: Unternehmensberaterin Nina, Account Manager Ina, EDV-Experte Theo und Manfred von der Telekom. Sie werden auf der Terrasse mit einem Glas Champagner begrüßt, den Waltraud von ihrem letzten Frankreichbesuch mitgebracht hat. Das Essen steht nicht im Mittelpunkt der Gespräche. Man stochert eher im Berufsleben des anderen. Privates und Allzuprivates bleiben unberührt. Selbst Manfred, der bei allen bisherigen „Runs“ dabei war und das Zusammenspiel gut kennt, zeigt sich nur gebremst vorwitzig. Auch beim Essen hält er sich zurück und greift zum Vegetarischen, da er seit einer Fischvergiftung kein Meeresgetier anrührt. Rudi hat derlei Abneigungen in seinem Computer festgehalten, um den Magen empfindlicher Teilnehmer zu schonen. An diesem Abend ist gar eine junge Frau dabei, die wegen einer Stoffwechselstörung keinerlei Fett zu sich nehmen kann, aber einfach Freude an dem ganzen Miteinander hat.
 Vorspeise und Hauptgericht liegen meist geographisch beisammen. In diesem Fall sind es gar nur zwei Schritte bis zum nächsten Tisch, denn Nina ist Nachbarin von Rudi und heute mit ihrem Kochpartner für das Hauptgericht zuständig. Erst war sie zwei Stunden Gast, jetzt wird sie zur Gastgeberin. Bei ihr gibt es gut gewürztes Thai-Hühnchen in Kokossauce, eine Delikatesse, die durchaus Restaurantniveau zeigt. Dennoch werden die Gäste nicht warm miteinander. Ganz anders bei Karin im Baumweg. Auf ihrem kleinen Balkon sitzen sechs „Runner“ und können gar nicht anders, als miteinander ins Gespräch kommen. Serviert wird ein Vollwertgericht aus Auberginen, Zucchini, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Olivenöl, Oregano, Mozzarella und Parmesan. Aus diesen Zutaten könnte man zwar etwas Gescheites machen, doch das hier ist geschmacksneutraler Klump. Was aber niemanden stört, weil man sich gutunterhält und die Zungen obendrein durch einen guten Sancerre beflügelt werden.
Vorspeise und Hauptgericht liegen meist geographisch beisammen. In diesem Fall sind es gar nur zwei Schritte bis zum nächsten Tisch, denn Nina ist Nachbarin von Rudi und heute mit ihrem Kochpartner für das Hauptgericht zuständig. Erst war sie zwei Stunden Gast, jetzt wird sie zur Gastgeberin. Bei ihr gibt es gut gewürztes Thai-Hühnchen in Kokossauce, eine Delikatesse, die durchaus Restaurantniveau zeigt. Dennoch werden die Gäste nicht warm miteinander. Ganz anders bei Karin im Baumweg. Auf ihrem kleinen Balkon sitzen sechs „Runner“ und können gar nicht anders, als miteinander ins Gespräch kommen. Serviert wird ein Vollwertgericht aus Auberginen, Zucchini, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Olivenöl, Oregano, Mozzarella und Parmesan. Aus diesen Zutaten könnte man zwar etwas Gescheites machen, doch das hier ist geschmacksneutraler Klump. Was aber niemanden stört, weil man sich gutunterhält und die Zungen obendrein durch einen guten Sancerre beflügelt werden.
Zum Dessert geht es in die Kriegkstraße ins Gallusviertel. Gastgeber Martin ist Journalist und schreibt bevorzugt über Wirtschaftsthemen. Er und seine ihm anvertraute Kochpartnerin Anja tischen als Dessert ein festlich geschmücktes Apfel-Tiramisu nebst Espresso auf. Bis auf ein Pärchen sind alle Gäste pünktlich um 22 Uhr beisammen. Nachdem eine halbe Stunde vergangen ist, ruft Rudy über Handy das Mobiltelefon der Vermissten. Diese sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und haben Anschlussschwierigkeiten. Zudem haben sie an einer U-Bahnstation einen Stuhl vergessen, den sie einem Dinner-Teilnehmer mitbringen sollten, der zu wenige Sitzgelegenheiten in seiner Wohnung hat.
 Um Mitternacht treffen sich alle Teilnehmer zu einem Abschlussdrink in einem Lokal, um den Abend noch einmal Revue passieren zu lassen. Die schnellste Nummer war eine Honigmelone mit Parmaschinken, während Birgit und Peter ihre Gäste feudal mit Seeteufel in Papaya-Salsa bewirteten und das Rezept dazu gleich schriftlich mit auf den Weg gaben. Rudy ist zufrieden, sein Motto, einen Abend mit „Nährwert“ und mit „Nähewert“ zu schaffen, ist wieder gelungen. Es gab auch kaum Fleisch, das er hätte stehen lassen müssen, denn als „liberaler“ Vegetarier isst er nur Fisch. Rudy Meidl hat Spaß an seinem Dinner on the Run, denn Geldverdienen könnte er damit nicht. Der studierte Mediziner und leidenschaftliche Pilot kann sich solche Hobbys leisten, denn als Schauspieler und Conferencier steht er recht gut im Futter.
Um Mitternacht treffen sich alle Teilnehmer zu einem Abschlussdrink in einem Lokal, um den Abend noch einmal Revue passieren zu lassen. Die schnellste Nummer war eine Honigmelone mit Parmaschinken, während Birgit und Peter ihre Gäste feudal mit Seeteufel in Papaya-Salsa bewirteten und das Rezept dazu gleich schriftlich mit auf den Weg gaben. Rudy ist zufrieden, sein Motto, einen Abend mit „Nährwert“ und mit „Nähewert“ zu schaffen, ist wieder gelungen. Es gab auch kaum Fleisch, das er hätte stehen lassen müssen, denn als „liberaler“ Vegetarier isst er nur Fisch. Rudy Meidl hat Spaß an seinem Dinner on the Run, denn Geldverdienen könnte er damit nicht. Der studierte Mediziner und leidenschaftliche Pilot kann sich solche Hobbys leisten, denn als Schauspieler und Conferencier steht er recht gut im Futter.
Bei der kulinarischen Kontaktbörse machen zwar die unterschiedlichsten Charaktere mit, doch lässt sich ein Mittelwert erstellen. Die Teilnehmer sind im Schnitt zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die Mittdreißiger dominieren. Nach den Erfahrungen des Veranstalters Rudy Meidl sind die meisten kontaktfreudig und weltoffen, wobei mehr Frauen als Männer dabei sind. Viele Singles, aber auch Paare. Vor allem Neu-Frankfurter nutzen die Chance, auf solch lockere Weise Kontakte zu knüpfen und die Stadt kennen zulernen. Nach den Worten von Rudy Meidl ist sein Dinner eine kulinarische Schnitzeljagd für kommunikative Genießer, aber kein Speed-Dating. „Es geht darum, einen ungewöhnlichen und abwechslungsreichen Abend mit netten Menschen zu erleben.“ Networking zum Anbeißen.
Dinner on the Run, Rudy C. Meidl, Telefon 069/35 35 30 96. www.dinner-on-the-run.de Teilnahmegebühr 16 Euro. Immer samstags, 1 x im Monat, wechselnd in Frankfurt und Darmstadt.





 Mehr Aussicht bietet die Aussichtsplattform auf der 124. und das Panorama-Lokal At.mosphere auf der 122. Etage. Sportliche dürfen 11.300 Stufen bewältigen. Küchenchef des höchsten Restaurants der Welt ist Dwayne Cheer aus Neuseeland. Vor seinem Aufstieg begann er im heimatlichen Waitarere in einem Fish & Chips-Laden am Strand. Nur einmal arbeitete Cheer in einem hoch bewerteten Restaurant – dem Greenhouse in London, wo der Michel Bras-Schüler Antonin Bonnet seit acht Jahren einen Michelin-Stern hält. Dwayne Cheer lebt seit über vier Jahren in Dubai und war dort als Chef de Cuisine und Executive Chef im One & Only Royal Mirage und den beiden Hotels The Address tätig, die wie der Burj Khalifa zur Emaar-Gruppe gehören. Für dieses Großunternehmen mit Sitz in Dubai arbeitet auch Viktor Stampfer als kulinarischer Direktor, der seine Hochzeit als Küchenchef im Frankfurter Restaurant Tigerpalast in den Jahren 2000 bis 2005 hatte und diesem hohe Bewertungen brachte (1 Michelin-Stern, 18 Punkte im Gault Millau).
Mehr Aussicht bietet die Aussichtsplattform auf der 124. und das Panorama-Lokal At.mosphere auf der 122. Etage. Sportliche dürfen 11.300 Stufen bewältigen. Küchenchef des höchsten Restaurants der Welt ist Dwayne Cheer aus Neuseeland. Vor seinem Aufstieg begann er im heimatlichen Waitarere in einem Fish & Chips-Laden am Strand. Nur einmal arbeitete Cheer in einem hoch bewerteten Restaurant – dem Greenhouse in London, wo der Michel Bras-Schüler Antonin Bonnet seit acht Jahren einen Michelin-Stern hält. Dwayne Cheer lebt seit über vier Jahren in Dubai und war dort als Chef de Cuisine und Executive Chef im One & Only Royal Mirage und den beiden Hotels The Address tätig, die wie der Burj Khalifa zur Emaar-Gruppe gehören. Für dieses Großunternehmen mit Sitz in Dubai arbeitet auch Viktor Stampfer als kulinarischer Direktor, der seine Hochzeit als Küchenchef im Frankfurter Restaurant Tigerpalast in den Jahren 2000 bis 2005 hatte und diesem hohe Bewertungen brachte (1 Michelin-Stern, 18 Punkte im Gault Millau).





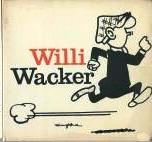



 Um Mitternacht treffen sich alle Teilnehmer zu einem Abschlussdrink in einem Lokal, um den Abend noch einmal Revue passieren zu lassen. Die schnellste Nummer war eine Honigmelone mit Parmaschinken, während Birgit und Peter ihre Gäste feudal mit Seeteufel in Papaya-Salsa bewirteten und das Rezept dazu gleich schriftlich mit auf den Weg gaben. Rudy ist zufrieden, sein Motto, einen Abend mit „Nährwert“ und mit „Nähewert“ zu schaffen, ist wieder gelungen. Es gab auch kaum Fleisch, das er hätte stehen lassen müssen, denn als „liberaler“ Vegetarier isst er nur Fisch. Rudy Meidl hat Spaß an seinem Dinner on the Run, denn Geldverdienen könnte er damit nicht. Der studierte Mediziner und leidenschaftliche Pilot kann sich solche Hobbys leisten, denn als Schauspieler und Conferencier steht er recht gut im Futter.
Um Mitternacht treffen sich alle Teilnehmer zu einem Abschlussdrink in einem Lokal, um den Abend noch einmal Revue passieren zu lassen. Die schnellste Nummer war eine Honigmelone mit Parmaschinken, während Birgit und Peter ihre Gäste feudal mit Seeteufel in Papaya-Salsa bewirteten und das Rezept dazu gleich schriftlich mit auf den Weg gaben. Rudy ist zufrieden, sein Motto, einen Abend mit „Nährwert“ und mit „Nähewert“ zu schaffen, ist wieder gelungen. Es gab auch kaum Fleisch, das er hätte stehen lassen müssen, denn als „liberaler“ Vegetarier isst er nur Fisch. Rudy Meidl hat Spaß an seinem Dinner on the Run, denn Geldverdienen könnte er damit nicht. Der studierte Mediziner und leidenschaftliche Pilot kann sich solche Hobbys leisten, denn als Schauspieler und Conferencier steht er recht gut im Futter.