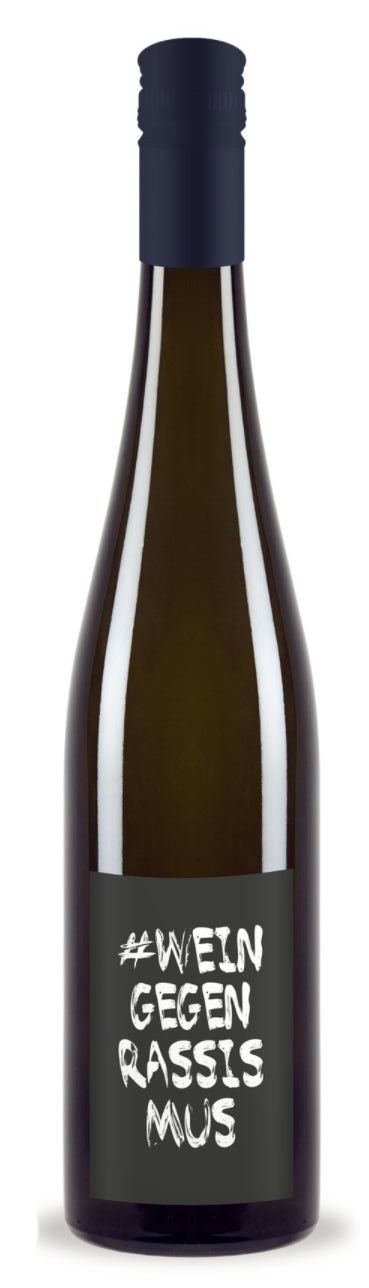Der Rheingau rockt weiter
Neue Pläne für 2017
Das Rheingau Gourmet- & Wein-Festival ist nie zu Ende. Nach dem Festival ist vor dem Festival. Die ersten Köche für 2017 sind bereits gebucht. Dieser Event ist seit 20 Jahren ein gesellschaftlicher Genussgipfel mit inzwischen über 6000 Besuchern. Viele der 64 Veranstaltungen waren auch jetzt wieder gleich ausgebucht, vor allem die hochpreisigen und speziellen. Zwei Wochen waren die Tafeln reich gedeckt, mit Menüs von Topköchen und Flaschen von Spitzenwinzern aus aller Welt. Doch das größte Gourmet-Festival hinterlässt auch stets Spuren und lässt tiefer blicken als in jedes Weinglas.

Tafelrunde
Das Gourmet-Festival weitet nicht nur den kulinarischen Horizont. Man darf auch sonst zu neuen Einsichten kommen. Erik van Loo, zwei Sterne-Koch aus Rotterdam, wirkt so, als würde er gleich eine Schlachtplatte servieren, immerhin kommt er auch aus einer Metzgerfamilie. Doch der bullige Chef arbeitet eher filigran. Seine handgefangenen rohen und nach peruanischer Ceviche-Art marinierten Jakobsmuscheln wurden nicht mit dem Hackebeil, sondern der Pinzette höchst fein zubereitet.
Auch Küchenstars haben ihre Gourmet-Groupies. Franzosen mehr als Deutsche. Klaus Erfort, Sven Elverfeld oder Christian Bau kochten fabelhaft, doch wenn einer wie Pierre Gagnaire aus Paris aufläuft, knistert es einfach. Man musste mehr Stühle anrücken als geplant. Der 3-Sterne-Koch war darüber trotz der Mehrarbeit sogar erfreut, denn er sah darin einen Gradmesser für seine Beliebtheit. Altmeister Gagniere brachte gute Laune und gleich drei Souschefs mit. Er hatte mit Simon Stirnal, dem neuen Küchenchef des Kronenschlösschens, auch einen richtigen Teamworker an der Seite. Bei 140 gleichzeitig abgeschickten Gängen muss jeder Handgriff sitzen.

2-Sterne-Koch Erik van Loo
Das Festival ist auch ein Wein-Festival. Die Damen verzichten inzwischen immer mehr auf Parfüm. Bei den Degustationen sind sie indes stets deutlich in der Minderheit. Schade, denn sensorisch hätten sie viel beizusteuern. Das gilt auch für die Wein-Moderation, die ebenfalls fast ausschließlich in Männerhänden liegt. Nicht immer in guten, denn manche hören sich gerne reden, erzählen episch breit und merken gar nicht, dass die Gäste viel lieber prägnant und amüsant informiert werden wollen und irgendwann ohnehin nicht mehr zuhören. Zum Glück sind oft bacchantische Fabulierer wie August F. Winkler dabei, denen man gerne lauscht. Auch die Sommeliers Hendrik Thoma und Kai Schattner plaudern salopp, aber eben fundiert lässig und vor allem kurzweilig.

Jakobsmuscheln von Erik van Loo
Für Weinkenner war sicher der Bordeaux-Gigant Le Pin in 20 Jahrgängen das herausragende Ereignis des Festivals. Dieser Raritäten Lunch wurde von einem gut gestimmten Jean-Claude Bourgueil kulinarisch begleitet. Er mag keine drei, sondern „nur“ noch zwei Michelin-Sterne haben, doch für den Festival-Gründer Hans Burkhardt Ullrich „kocht er besser denn je“. Der Le Pin Mittag kostete 1.980 €, wenn man jedoch bedenkt, dass allein für eine Flasche vom servierten Jahrgang 1983 über 2000 € verlangt wird, relativiert sich dies überdeutlich. Daneben konnte man für einen netten Betrag auch andere großartige Weine verkosten, 85 € für neun Jahrgänge der Bordeaux-Brüder Haut Batailley und Grand-Puy-Lacoste bot auch Anfängern einen sehr guten Einstieg. Die Weine wurden einen Tag zuvor geöffnet, aber nicht dekantiert, was sich als richtig erwies. Und wieder einmal zeigt, welch nachteilige Bedienung Gäste im Restaurant erfahren, wo ja auch große Weine erst nach der Bestellung entkorkt werden und keinesfalls optimal schmecken können. Die Jahrgänge 2006 und 2009 von Château Grand-Puy-Lacoste präsentierten sich optimal saftig und fleischig und schmeckten faunisch nach Waldboden und roten Beeren. Der große Italiener Sassicaia ist ein geistig Verwandter im Bordeaux-Stil, der seine Klasse vor allem mit dem kräuterwürzigen und erotischen Jahrgang 2004 zeigte.

Weinexperte & Moderator Jan Paulson
Das Rheingau Gourmet- und Wein-Festival ist auch eine Schule und bietet Lehrstunden. Wenn unterschiedliche Hummer aus Maine, Irland und der Bretagne mit verschiedenen Saucen zu verkosten sind, so kann man sehen, welches Produkt besonders gut ist und welche Sauce am besten passt. Ähnliches gilt für Verkostungen, bei denen man spitzfindig entdecken darf, welches Glas zu welcher Rebsorte besonders gut passt. Zum sinnlichen Seminar wurde die Wiederholung des legendären Paris-Wein-Tastings von 1976, bei dem während einer Blindprobe französische gegen kalifornische Chardonnays sowie verschiedene Cabernet Sauvignons antraten. Das Ergebnis überraschte die Weinwelt kolossal, denn die kalifornischen Weißen und Roten schnitten deutlich besser als die französischen ab. Auch beim Gourmet-Festival im Rheingau war das Resultat 40 Jahre später wieder genau so.

Sommelier Hendrik Thoma (l.) und Dodo Freiherr zu Knyphausen vom Weingut August Eser
Das Rheingau Gourmet & Wein-Festival ist obendrein ein gesellschaftliches Ereignis. Man sieht die, die man kennt und begegnet denen, die man vielleicht noch kennenlernen sollte. Winzer, Köche und die Gäste nutzen das Festival zum Networking, denn wo sonst trifft man auf so viele Genießer und Gleichgesinnte. Festivalchef, HB Ullrich, nahm teilweise an zwei parallel verlaufenden Events gleichzeitig teil, weil auch er selbst nach 20 Festival-Jahren immer noch ungemein neugierig auf die Köche, Winzer und Gäste ist. Das Programm für 2017 ist bereits in Arbeit. Als gebucht gilt der holländische Sterne-Koch Erik van Loo, weil er bei Ullrich und den Gästen besonders gut ankam. Statt der 64 Programmpunkte soll es künftig nur noch 50 Events geben. Ein großes Thema wird „Kalifornien“ sein, was sehr viel Spielraum und Entdeckungen für Essen und Weine gibt. Ein Tag soll Israel gewidmet werden.
Ludwig Fienhold
Bild oben rechts: Kunst im Weinkeller von Georg Müller in Hattenheim, wo viele Weinverkostungen stattfanden.
Photocredit: Barbara Fienhold
Das Rheingau Gourmet- und Wein-Festival ist zu Ende, doch das Jahresprogramm des Kronenschlösschen geht weiter und bietet ebenfalls spannende Events: www.kronenschloesschen.de