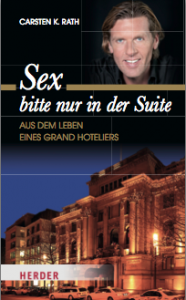Experte Carsten K. Rath
schreibt an die Hoteliers und
Gastronomen der Zukunft
Es gibt viele Gründe, warum Menschen glauben, sie können in ihrem Leben ein Restaurant eröffnen oder gar ein Hotel führen. Mindestens genauso viele Gründe gibt es, warum Menschen denken, das sei einfach. Das ist ein bisschen wie mit den 80 Millionen deutschen Bundestrainern, die die Nationalmannschaft besser aufstellen können als Jogi Löw: Fast jeder hat schon einmal Fußball gespielt und meint deshalb, er könne diesen Job beurteilen. Genauso hat jeder schon in Restaurants gegessen oder war zu Gast in einem Hotel und glaubt, Bescheid zu wissen. Hoteliers sind über dieses Phänomen ein bisschen amüsiert und auch ein bisschen genervt, es heißt dann: »Jeder, der schon mal erfolgreich einen Cappuccino getrunken hat, fühlt sich zum Hotelier berufen.«
Was wir da so tun, mag aussehen wie Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll. So sah es auch für mich aus, bevor ich in die Hotellerie einstieg. Und das soll es auch – für die Gäste. Doch in Wahrheit ist es eher Blood & Sweat & Tears.
Wir erleben alle immer wieder ordentlichen, manchmal sehr guten und häufig weniger guten Service. Aus unserer Perspektive als Kunde sind wir dann davon überzeugt, ein Gefühl dafür entwickelt zu haben, was gut ist oder was wir als gut empfinden. Und daraus basteln wir uns dann einen Maßstab. Reicht das, um erfolgreich ein Service-Unternehmen zu führen? Die meisten glauben – ja.
 Doch ganz so einfach ist es nicht. Auch wenn ich einen Cappuccino machen kann, bin ich deswegen noch lange kein Gastronom. Exzellenter Service erwächst nicht aus einer Fertigkeit, sondern aus der Empathie für den Gast. Es gibt sie nicht auf Knopfdruck aus dem Kaffee-Vollautomaten. Wir Hoteliers sehen uns heute sehr erfahrenen und stets bestens informierten Reisenden gegenüber. Gästen, die viele Erfahrungen rund um den Globus machen. Unsere Gäste kennen die Herzlichkeit der Balinesen ebenso wie die State of the Art Service Centres mit den schnellsten Internetzugängen in New York, die Business Suiten in Frankfurt genauso wie die Übersetzungsdienste in koreanischen Taxis. Sie kennen die Seifen-Concierges von Ritz-Carlton, die abends vom Bauchladen aus den Gästen zum Turn-down-Service eine große Auswahl der feinsten Waschutensilien reichen. Bei Hochzeiten auf den Malediven haben sie Romantik pur erlebt und in Familienhotels oder Resorts wie den Robinson-Clubs Sport, Wellness und Action auf Weltklasse-Niveau genossen. Sie haben Kobe-Steaks in Japan gegessen und kennen sich mit organischem Gemüse aus dem Hochland von Bhutan aus.
Doch ganz so einfach ist es nicht. Auch wenn ich einen Cappuccino machen kann, bin ich deswegen noch lange kein Gastronom. Exzellenter Service erwächst nicht aus einer Fertigkeit, sondern aus der Empathie für den Gast. Es gibt sie nicht auf Knopfdruck aus dem Kaffee-Vollautomaten. Wir Hoteliers sehen uns heute sehr erfahrenen und stets bestens informierten Reisenden gegenüber. Gästen, die viele Erfahrungen rund um den Globus machen. Unsere Gäste kennen die Herzlichkeit der Balinesen ebenso wie die State of the Art Service Centres mit den schnellsten Internetzugängen in New York, die Business Suiten in Frankfurt genauso wie die Übersetzungsdienste in koreanischen Taxis. Sie kennen die Seifen-Concierges von Ritz-Carlton, die abends vom Bauchladen aus den Gästen zum Turn-down-Service eine große Auswahl der feinsten Waschutensilien reichen. Bei Hochzeiten auf den Malediven haben sie Romantik pur erlebt und in Familienhotels oder Resorts wie den Robinson-Clubs Sport, Wellness und Action auf Weltklasse-Niveau genossen. Sie haben Kobe-Steaks in Japan gegessen und kennen sich mit organischem Gemüse aus dem Hochland von Bhutan aus.
Diese Menschen, denen man nichts vormachen kann, sind unsere Gäste. Ihre gesammelten Service-Erlebnisse haben sich auf ihrer Festplatte eingebrannt. Bei jedem neuen Hotelaufenthalt werden sie abgerufen und mit der aktuellen Service-Erfahrung abgeglichen. Top oder Flop? Für uns bedeutet das, frei nach Sepp Herberger: Nach dem Besuch ist vor dem Besuch. Wir Gastronomen sind immer nur so gut wie das letzte Essen, das wir serviert haben.
 Worauf lässt man sich also ein, wenn man heute Grand Hotelier oder auch Top-Gastronom werden möchte? Was zeichnet den Gastgeber des 21. Jahrhunderts aus, der sich diesen Herausforderungen stellen darf? Hoteliers müssen, im Unterschied zu vielen anderen Berufen, bei ihren Kunden in die Tiefe und in die Breite denken und fühlen. Als Hotelier braucht man Leidenschaft und Ausdauer. Hier ist kein schnelles Geld zu machen. Ähnlich sieht es in der Gastronomie aus. Im Gastgewerbe – dem zweitältesten Gewerbe der Welt – kann man nur noch mit nachhaltiger Rundumbetreuung Gäste, nein: Freunde fürs Leben gewinnen. Hinter einem Tresen hervorzulächeln, so wie in der Werbung, reicht längst nicht mehr.
Worauf lässt man sich also ein, wenn man heute Grand Hotelier oder auch Top-Gastronom werden möchte? Was zeichnet den Gastgeber des 21. Jahrhunderts aus, der sich diesen Herausforderungen stellen darf? Hoteliers müssen, im Unterschied zu vielen anderen Berufen, bei ihren Kunden in die Tiefe und in die Breite denken und fühlen. Als Hotelier braucht man Leidenschaft und Ausdauer. Hier ist kein schnelles Geld zu machen. Ähnlich sieht es in der Gastronomie aus. Im Gastgewerbe – dem zweitältesten Gewerbe der Welt – kann man nur noch mit nachhaltiger Rundumbetreuung Gäste, nein: Freunde fürs Leben gewinnen. Hinter einem Tresen hervorzulächeln, so wie in der Werbung, reicht längst nicht mehr.
Die Aufgabe eines Hoteliers besteht darin, alles zu tun, damit der Gast sich wirklich wohlfühlt. Alles. Das klingt so einfach – und ist es doch nicht. Den hybriden Kunden kann nur noch überzeugen, wer sich aufrichtig für ihn interessiert und sich physisch, emotional, kulinarisch, manchmal sogar psychologisch und immer persönlich um ihn kümmert – vom Moment seiner Ankunft bis zur Abreise. In anderen Branchen gibt es Öffnungszeiten, in manchen sogar Betriebsferien – nicht bei uns. Wir Hoteliers sind 24 Stunden, 365 Tage, ein Leben lang für unsere Gäste da. Gastgeber haben keine Öffnungszeiten. Was auch immer im letzten Moment verändert oder langfristig optimiert werden muss, geschieht bei uns im laufenden Betrieb – wir schließen nie.
 Hotels sollten maßgeblich zur Steigerung unserer Lebensqualität beitragen, denn viele unserer Kunden verbringen erhebliche Teile ihres Lebens in Restaurants und Hotels. Und manchmal, zum Glück nur ganz selten, reisen sie sogar »kalt« ab, wie wir das in der Hotellerie nennen. Tatsächlich hatte eine alte Dame, die bei uns im Hotel Grand Roche in Paarl praktisch lebte, verfügt, ihre Asche möge von uns über dem Tafelberg verstreut werden. Sie starb nicht im Hotel, aber ihre letzte Anreise tätigte sie in einer Urne, versehen mit einer Kopie jenes Testaments, in dem sie uns bat, ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Und wir streuten ihre Asche über dem Tafelberg aus.
Hotels sollten maßgeblich zur Steigerung unserer Lebensqualität beitragen, denn viele unserer Kunden verbringen erhebliche Teile ihres Lebens in Restaurants und Hotels. Und manchmal, zum Glück nur ganz selten, reisen sie sogar »kalt« ab, wie wir das in der Hotellerie nennen. Tatsächlich hatte eine alte Dame, die bei uns im Hotel Grand Roche in Paarl praktisch lebte, verfügt, ihre Asche möge von uns über dem Tafelberg verstreut werden. Sie starb nicht im Hotel, aber ihre letzte Anreise tätigte sie in einer Urne, versehen mit einer Kopie jenes Testaments, in dem sie uns bat, ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Und wir streuten ihre Asche über dem Tafelberg aus.
Unsere Gäste erwarten zu Recht, dass wir uns liebevoll um sie kümmern, während sie oft weit weg von ihren Familien sind. Sie verlassen sich darauf, dass wir ihnen fern von zu Hause ein Zuhause bieten. Sie wollen aber auch inspiriert und überrascht werden. Sie erwarten außergewöhnliche Erlebnisse, Harmonie und maximalen Komfort. Am liebsten – das ist für beide Seiten der Idealfall – möchten sie mit der Hotelmarke eine Beziehung eingehen. Kurz: Sie wollen ein Hotel, das ihr Leben lebenswert macht. Deshalb gibt es für Hoteliers vor allem dieses eine Gesetz, das alles andere begründet und bedingt. Ich habe dies von meinem geschätzten Kollegen und Freund, dem Grand Hotelier Frank Marrenbach, CEO der Oetker Hotel Collection, gelernt: M4 = Man muss Menschen mögen.
Hotelgäste erwarten für die Zeit ihres Aufenthalts das perfekte Leben. We make it happen! Leicht ist das nicht. Doch wenn es gelingt, dann ist Hotelier die schönste Aufgabe der Welt.
Der Hotelier Carsten K. Rath hat ein flottes Buch geschrieben: Sex bitte nur in der Suite. Als Insider erzählt er von Menschen im Hotel, von Prominenten und anderen Paradiesvögeln. Dabei bekommt der Leser einen interessanten Blick hinter die Kulissen der Fünf-Sterne-Welt. Der hier an dieser Stelle veröffentlichte Auszug ist vielleicht weniger brisant und investigativ als die anderen, zeigt aber die Ansprüche und Nöte eines Hoteliers und Gastronomen in unserer Zeit. Carsten K. Rath hat gerade sein Hotel Kameha Grand in Zürich eröffnet. Außerdem betreibt er die Kameha Suite in Frankfurt.
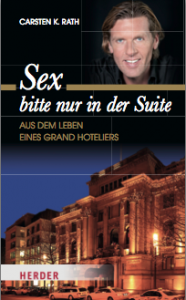
Carsten K. Rath
Sex bitte nur in der Suite
Aus dem Leben eines Grand-Hoteliers
Klappenbroschur, 288 Seiten,
19,99 €.
Herder Verlag. Auch als Audio-CD, 17,99 €.
Bilder aus dem großartigen Film The Grand Budapest Hotel